Immersion, die – Eintauchen in eine virtuelle Umgebung
(Duden online: https://www.duden.de/node/70151/revision/70187 , Abrufdatum 19.10.2019)
Was macht einen guten Film aus, ein spannendes Buch, oder eine grandiose Erzählung? Man fühlt sich, als wäre man dabei. Man durchbricht die vierte Wand, wird vom beistehenden Beobachter direkt auf den Beifahrersitz katapultiert und erlebt die Emotionen eines anderen hautnah mit.
Bei guten Spielen ist das nichts anderes. Zumal man dort die Steuerung übernimmt und Entscheidungen selbst trifft, um dann die Konsequenzen zu spüren.
Und es ist verrückt, wie nahe es etwas tatsächlich Selbsterlebtem kommt.
Das Gefühl von Stolz und Schuld
In einem recht alten Spiel, Fable II, hat die Hauptfigur einen Hund. Ein liebevoll animiertes Tier, das man streicheln, loben und mit Bällchenspielen belohnen kann – und eben auch ausschimpfen und verletzt zurücklassen, woraufhin sich der Hund mit dem Ausdruck tiefsten Unverständnisses, Fiepen und Jaulen zurückzieht oder langsam und leidend hinter einem her humpelt. Natürlich existiert der Hund nicht, hat er nie. Es gibt keine realen Gefühle zu verletzen. Er würde kein Trauma davontragen, denn nach Beenden des Spiels wäre er einfach verschwunden. Trotzdem, es war mir schlicht unmöglich, diesen Haufen in Form gebrachte Pixel schlecht zu behandeln. Und als ich es probeweise einmal doch getan habe, hat mich das schlechte Gewissen noch tagelang verfolgt.
Auch in anderen Situationen entdecke ich reale Gefühle in virtueller Realität, Schuld nach falschen Entscheidungen, Freude nach Heldentaten, wenn ein gerettetes Dorf den Namen meiner Figur mit Ehrfurcht und Dankbarkeit ausspricht. Im ersten Spiel der besagten Fable-Reihe entwickelte der Protagonist nach überwiegend guten Taten sogar einen Heiligenschein, samt Schmetterlingen drum. Ein wahrhaft erhabenes Gefühl. Irgendwie.
In anderen Spielen erhalte ich als Anführer die Verantwortung für eine Reihe von Nebenfiguren, die sich meinem Team anschließen, meinem Befehl unterordnen und versichern, es sei ihnen eine Ehre, für mich zu kämpfen. Je mehr Zeit man mit ihnen verbringt – und in dieser Art von Spielen hat man lange, recht tiefsinnige Unterhaltungen und tauscht nach und nach sogar Kindheitserinnerungen und Gemeinsamkeiten aus – desto mehr wachsen sie einem ans Herz. Natürlich schreitet die Storyline weiter fort, und meist geht es um einen unbesiegbar scheinenden Gegner; dabei wird klar, dass es Opfer erfordern wird, ihn zu besiegen. Aus meiner Gruppe könnten die liebgewonnenen Figuren sterben.
In Mass Effect schicke ich einen meiner Leute los, um eine für die Mission wichtige Sache zu erledigen – etwas, das er nicht überlebt. Spätestens beim zweiten Durchspielen weiß ich das bereits, wenn ich den eifrigen Freiwilligen auswähle. Es ist spannend zu sehen, was das mit mir macht. Ich hüte mich schon im Vorfeld, zu sehr mit ihm Freundschaft zu schließen. Auch wenn die Figur nie existiert hat und natürlich daher auch nie wirklich stirbt, belastet es mich. Und für den Moment fühlt sich das real an.
Echt oder künstlich?
Natürlich sind echt empfundene Gefühle in virtuellem Setting so eine Sache. Es ist meines Erachtens nach falsch zu sagen, sie wären den Gefühlen im wirklichen Leben tatsächlich ebenbürtig. Es wird sogar bedenklich, wenn es bei einigen dahingehend vorbelasteten Menschen soweit kommt. Auch wenn mich der Tod einiger Figuren erschüttert hat und ich noch immer mit leichter Trauer an sie zurückdenke, weiß ich natürlich und mit absoluter Sicherheit, dass sie nicht wirklich existieren. Meine Trauer, meine Angst, die Spannung und Freude sind nur Abziehbilder echter Gefühle. Für den Moment sind sie real, und ich kann sie auch als solche genießen. Einiges hängt mir auch länger nach. Aber natürlich kann ich im virtuellen Umfeld gegnerische Wesen töten, ohne dass das bedeutet, dass ich im echten Leben auch nur eine Waffe anfassen könnte, um sie auf andere zu richten.
Das ist etwas, was in Diskussionen mit genrefremden Menschen gerne über einen Kamm geschoren wird. Dabei war, glaube ich, jeder von uns schon einmal ehrlich erschrocken, wenn ein Monster aus dem Nichts auf uns als Kinozuschauer zugesprungen kommt – und das heißt dennoch nicht, dass wir ehrlich Angst vor Monstern haben. Vielleicht haben wir uns auch schonmal geduckt, wenn das Raumschiff über unsere Köpfe geschossen ist – was nicht heißt, dass wir wirklich dachten, es könne uns das Haupthaar abrasieren. Und eventuell hat jemand von euch auch beim Ende von Titanic geweint, auch wenn wir sicher wussten, dass Leonardo di Caprio immer noch lebt und weiter tolle Filme macht.
Auch wenn diese Gefühle für den Augenblick echt sind, sich echt anfühlen und auch echte physiologische Reaktionen in uns auslösen – und dafür konsumieren und genießen wir diese Medien ja auch – heißt es nicht, dass wir das nach Ende des Films/Spiels/Buchs nicht abstrahieren können.
Nicht ohne Grund erfasst uns eine besondere Beklommenheit, wenn wir nach dem Psychothriller die Worte lesen: „Nach einer wahren Begebenheit“. Dann bekommen die zuvor mit hingebungsvollem Grusel genossenen Filmszenen eine ganz andere Textur. Weil sie sich vielleicht echt angefühlt haben, aber immer noch eine dünne Schicht Distanz darüber lag, die dann mit einem Mal fortgerissen wird.
Immersion ist ein tolles Stilmittel, etwas, das es uns ermöglicht, in fremde Welten einzutauchen, ohne unseren Platz zu verlassen, und aufregenden Gefahren auszusetzen, ohne in Gefahr zu geraten.
In Videospielen erlaubt es uns darüber hinaus auch, die eigenen heldenhaften oder skrupellosen Seiten auszutesten, ohne echte Konsequenzen. Nicht nur ein Abenteuer mitzuerleben, sondern den Weg selbst zu wählen und zu formen. Soziale Bindungen zu erarbeiten und am Leben zu erhalten, mit dem Vorteil der Gelinggarantie und dem Nachteil der Möglichkeit eines tragischen Endes.
Das Erleben in diesen Welten ist real – und dann auch wieder nicht. Natürlich war ich nie im Venedig des fünfzehnten Jahrhunderts oder im London des neunzehnten, und gottlob hat sich nie ein loyaler Freund und Weggefährte für mich opfern müssen oder habe ich mich nur mit einem Schwert bewaffnet einer Armee von Monstern gegenübergesehen.
Und dennoch habe ich all das erlebt, in Spielen, in Büchern und Filmen. Für den Moment, für ein Teil von mir, war es echt, und daher umso näher und großartiger.
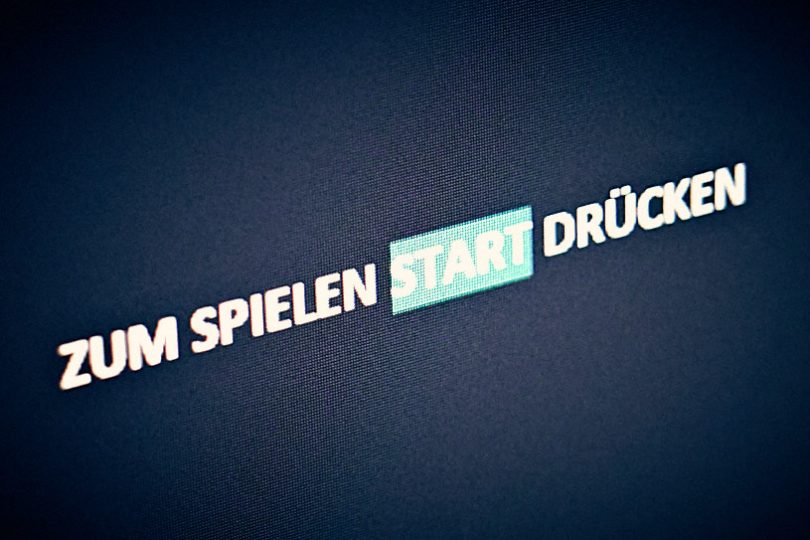

Ach, wie oft hatte ich das schon, dass eine Figur in einer Serie stirbt und ich hinterher ein Häufchen Elend war? Aber, und das ist eben der Unterschied zum wahren Leben, ich kann einfach alte Folgen noch einmal schauen, in denen die Figur noch lebt. Beim Schreiben ist das ähnlich: Selbst wenn ich eine Figur töte, ist sie für mich nie wirklich weg, weil ich mir immer noch ihr ganzes Leben davor ausdenken kann.
Letzten Endes ist es immer ein gutes Zeichen, wenn man sich derart in der Geschichte „verliert“ (unabhängig vom Medium). Ich merke das gerade, während ich „Artemis“ von Andy Weir lese. Obwohl ich das Buch mag, ist es streckenweise zu genau und technisch, ich bin mir die ganze Zeit dessen bewusst, dass ich nur einen Text lese, wenn auch einen sehr präzisen. Auch Leerstellen sind offenbar wichtig, um sich hineinfallen lassen zu können.
Also, echt spannendes Thema … 🙂
Hm. Ja. Für den Moment. Man kann es auch so sehen, dass nur der Moment existiert. Alles andere ist nicht. Aber das ist es gar nicht, was ich eigentlich sagen wollte. Für mich ist es einfach der Moment, das Gefühl die Empfindung und wenn das für mein Herz richtig und wahrhaftig ist, dann ist es vollkommen gleichgültig Wie, Woher und Warum.